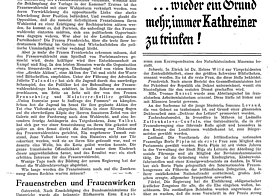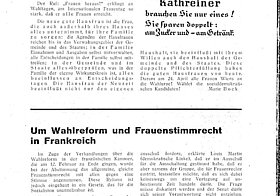Auch diesen Sommer finden wieder jährliche Revisionsarbeiten statt, daher bleiben die Lesesäle am Standort Heldenplatz und in allen Sammlungen von Freitag, 25. Juli bis Dienstag, 5. August 2025 geschlossen.
Aufgrund der Abschaltung des Bestellsystems können von Donnerstag, 24. Juli 2025, 16 Uhr bis Dienstag, 5. August 2025, 16 Uhr keine Medienbestellungen angenommen werden. Ab Mittwoch, 6. August 2025 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.
Der Studiensaal der Albertina ist von 15. Juli bis 15. August geschlossen. Während dieser Zeit (ausgenommen 25. Juli bis 5. August) werden bestellte Medien des Albertinabestandes zweimal wöchentlich (Montag und Donnerstag) in die Lesesäle der Nationalbibliothek am Heldenplatz transportiert und können dort verwendet werden.
Aufgrund einer Veranstaltung bleibt der Prunksaal am 4. August 2025 ganztägig geschlossen.
Die Geschichte des Kampfes um politische Rechte in Frankreich weist ein markantes Ereignis auf: die Französische Revolution. Sie wurde zum Symbol des Aufstandes der breiten Bevölkerung gegen die Herrschenden. In der Realität waren den Revolutionären Frauen als Mitstreiterinnen willkommen, blieben aber von den Menschen- und Bürgerrechten ausgeschlossen. Olympe de Gouges formulierte 1792 die „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“. Sie argumentierte darin, dass den Frauen, wenn sie dazu verurteilt werden können, durch die Guillotine zu sterben, auch das Recht zustehe, politische Entscheidungen mitzutragen. Ein Jahr später wurde sie selbst hingerichtet. Ihre Schriften wurden für lange Zeit vergessen.
In den revolutionären Bewegungen von 1830 und 1848 erlebten Frauen einen Aufbruch, der sich nicht nur in der Teilnahme an den Aufständen, sondern ebenso in der Gründung von Frauenzeitungen und Clubs zeigte. Doch die Frauenclubs, die 1848 von der provisorischen Regierung das allgemeine Wahlrecht und die Gleichheit vor dem Gesetz gefordert hatten, wurden bald verboten. In der Pariser Kommune von 1871 standen Frauen nicht nur auf den Barrikaden, sondern brachten wiederum ihre Forderungen nach Gleichheit ein. Der Rat der Kommune blieb ein Rat der Männer, unter den 90 Mitgliedern gab es keine einzige Frau.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand eine Frauenrechtsbewegung. Hubertine Auclert gilt als eine ihrer wichtigsten Aktivistinnen. 1876 war sie unter den Gründerinnen des ersten Frauenstimmrechtsvereins Frankreichs. Mit Artikeln sowie mit hunderten Petitionen und in öffentlichen Reden trat sie für die vollen Bürgerrechte von Frauen auf allen Gebieten ein.
Im 20. Jahrhundert scheiterten Gesetzesvorlagen für das Frauenwahlrecht mehrmals am Widerstand der Abgeordneten in der Nationalversammlung. 1919 stimmte das Abgeordnetenhaus dem Frauenwahlrecht zwar zu, der Senat jedoch nicht. Vor allem die Radikalliberalen hielten die Frauen nicht für fähig, politische Entscheidungen zu treffen und befürchteten Stimmenvorteile für die katholische Partei. Schließlich wurde das Frauenwahlrecht 1944 per Dekret von Charles de Gaulle eingeführt.